Studie zeigt Handlungsbedarf auf : FEEI warnt - Industriestandort in Gefahr
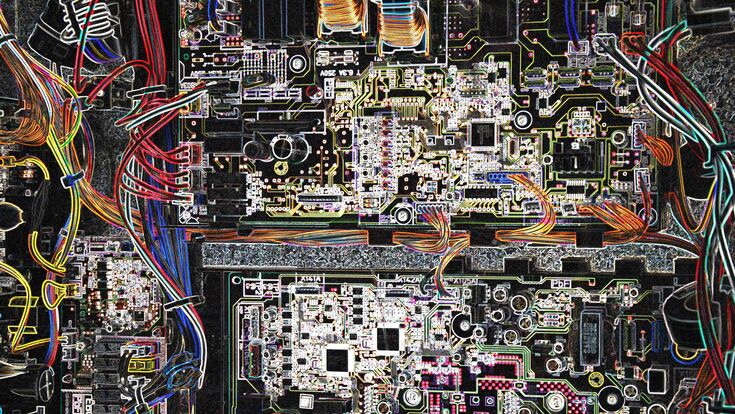
Rezession, steigende Energie-/Lohnkosten, Überbürokratisierung & Co. schwächen den Industriestandort Österreich und haben auch starke Auswirkungen auf die heimische Elektro- und Elektronikindustrie
- © HLK/ E. Herrmann„Die Vielzahl aktueller globaler Herausforderungen hat Auswirkungen auf unsere Wirtschaft, ganz besonders auf die exportstarke Elektro- und Elektronikindustrie“, sagt FEEI-Obmann Wolfgang Hesoun im Rahmen eines Pressegesprächs am 30.10.2024 (mit Verweis auf die Jahrespressekonferenz des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie/ FEEI vom 10. Oktober 2024). Eine anhaltende Rezession, stetig steigende Lohn- und Energiekosten sowie Überbürokratisierung schwächen den Industriestandort Österreich zunehmend.
„Die derzeitigen Entwicklungen gefährden Wertschöpfung, Arbeitsplätze und in weiterer Folge das Aufrechterhalten unseres funktionierenden Sozialstaates durch zurückgehende Steuereinnahmen. Das geht zulasten unseres Wohlstands und damit des sozialen Friedens im Land“, so Hesoun.
Die exportstarke Elektro- und Elektronikindustrie ist davon besonders betroffen und verzeichnete bereits 2023 einen Negativtrend: sinkende Auftragseingänge, rückläufiger Export, Abbau von Fremdpersonal. 2024 spitze sich die Lage weiter zu.
Bedeutung der produzierenden Industrie
Die hohen Einnahmen durch die exportstarke Industrie ermöglichen es, das im Ausland verdiente Geld großzügig im Inland zu investieren - sei es im Handel oder in Dienstleistungen. Jobs in der Industrie sind oft hochdotiert, was zu entsprechenden Steuereinnahmen führt.
Das benötigte Know-how wird durch lange und spezielle Ausbildungen erworben und bringt einen massiven Standortvorteil. Im Licht der aktuellen Entwicklungen besteht allerdings die Gefahr, dass Unternehmen abwandern, Forschung & Entwicklung sowie Produktion verlagern und Stellen abbauen. Für die sehr wissens-, kosten- und anlageintensive Industrie ist das besonders schwerwiegend - denn ist sie erst einmal abgewandert, kann sie nicht einfach wieder aufgebaut werden.
Darüber hinaus ist die produzierende Industrie Garant für den uneingeschränkten und steten Zugriff auf lebensnotwendige Güter und Ressourcen wie Wasser, Energie, Arzneimittel und Medizinprodukte. Im Falle eines Blackouts oder Cyberangriffs ist es auch die Elektro- und Elektronikindustrie (EEI), die kritische Infrastruktur aufrechterhält. Um die Bedeutung der Branche in Zahlen abzubilden, hat der FEEI eine Studie beim Industriewissenschaftlichen Institut (IWI) in Auftrag gegeben. Diese zeigt anhand einer Szenarien-Betrachtung bis 2030, welche Folgen fehlende Rahmenbedingungen gesamtwirtschaftlich auf Österreich haben
Studie gibt Aufschluss über Bedeutung der EEI
Studienleiter Herwig Schneider betont: „Die EEI ist ein zentraler Teil der Industrie. Sie gibt wichtige Impulse, ist in komplexe Wertschöpfungsketten eingebettet und hat Auswirkungen auf viele andere Branchen wie Handel, Bau und Dienstleistungen.“
Das Industriewissenschaftliche Institut beleuchtet im Rahmen der Studie, welche Auswirkungen die Industriepolitik der kommenden Jahre auf den Wirtschaftsstandort haben wird. Bleiben die Arbeitskosten weiterhin auf einem hohen Niveau - Österreich hat EU-weit 2023 die dritthöchsten Lohnstückkosten (!) - so bleiben Investitionen aus und die Produktion verlagert sich ins Ausland. Dieses realistische Szenario birgt hohe Risiken: Verglichen zum berechneten Good-Case-Szenario, in dem eine Fortschreibung der EEI-Entwicklung der letzten 20 Jahre angenommen wird, ergibt das ein Minus an Steuern und Sozialbeiträgen von 1,43 Mrd. Euro, ein Wertschöpfungsminus von 4,58 Mrd. Euro und rund 36.100 Arbeitsplätze weniger.
Es geht allerdings noch schlimmer - und auch diese Option ist durchaus realistisch: Das Worst-Case-Szenario geht davon aus, dass sich aktuelle Rahmenbedingungen wie hohe Energiekosten, globale Wettbewerbsverzerrungen und Bürokratie weiter verschlechtern, während zeitgleich die USA und China Maßnahmen setzen, um die eigene Wettbewerbsposition weiter auszubauen. Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen wären ein Verlust von Steuern und Sozialbeiträgen in Höhe von 2,63 Mrd. Euro, ein Wertschöpfungsverlust von 8,44 Mrd. Euro und rund 66.400 Arbeitsplätze weniger, als durch passende Rahmenbedingungen möglich wären.
„Es liegt nun an der Politik, den Weckruf der Industrie, der allerorts zu hören ist, ernst zu nehmen und durch nachhaltiges Systemdenken sowie eine aktive Industriepolitik die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen“, so Wolfgang Hesoun.

Forderungen an die Politik
Hesoun plädiert für eine strategisch sinnvolle Handels- und Europapolitik sowie Anreize, Wertschöpfung nach Europa zu holen und hier zu halten. Konkret fordert er Investitionsanreize, wie etwa den Investitionsfreibetrag, eine Änderung in der öffentlichen Beschaffung mit Fokus auf Stärkung der europäischen Wirtschaft, gezielte Forschungsförderung in Europa, eine Senkung der Lohnnebenkosten und den Abbau von Bürokratie.
Gerade beim letzten Punkt ist aber das genaue Gegenteil im Gang, vor allem „dank“ der EU.
Bürokratie-Aufbau durch die EU
Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) für Unternehmen ist nur eines von vielen Beispielen, wie die EU in der Vergangenheit und aktuell für mehr Bürokratie sorgt(e). Es verpflichtet Unternehmen (vorerst mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden und mehr als 450 Mio. Euro Umsatz) dazu, die Menschenrechte und Umweltstandards innerhalb ihrer Wertschöpfungskette zu berücksichtigen. Das bringt einen hohen Aufwand mit sich und ist teilweise in der Praxis gar nicht erhebbar.
Weitere Beispiele: EU-Konfliktmineralien-Verordnung, die EU-Entwaldungs-Verordnung (EUDR), das EU-Renaturierungsgesetz (u. a. müssen rund 20 % der Land- und Meeresflächen der EU renaturiert werden; drei Milliarden zusätzliche Bäume sind bis 2030 zu pflanzen), die EU F-Gase-Verordnung oder die REACH/ PFAS Verordnung, die voraussichtlich ab 2025 nahezu alle Industriezweige mehr oder weniger stark betreffen wird. Für manche mitunter der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und Grund zur Überlegung, sich außerhalb des EU-Raumes anzusiedeln.
Dass sich durch EU-Vorgaben, von denen die Bürger meist weniger Detail-Kenntnis haben, auch schnell für Verbraucher etwas ändern kann, zeigt sich u. a. bei Fahrzeugen. Durch die Vehicle General Safety Regulation der EU, die zu den bestehenden noch weitere spezifische Assistenzsysteme in Neuwagen vorgibt (u. a. Kopfaufprallschutz, Rückfahrassistent, intelligenter Geschwindigkeitsassistent,….) werden Fahrzeuge zwar sicherer, aber auch komplizierter und vor allem teurer. Bei Kleinfahrzeugen verteuert das den Kfz-Preis eklatant. Konsequenz: Viele Kleinfahrzeuge sind bereits vom Markt verschwunden, werden nicht mehr in Europa angeboten und produziert. Ähnliches gilt für die Fertigung von Benzin- und Diesel-Motoren und die damit einhergehenden Arbeitsplätze sowie das Know-how - nachdem die EU verkündete, dass Benzin und Diesel betriebenen Verbrennungsmotoren bei Neuwagen ab 2035 nicht mehr zugelassen werden sollen (Ausnahme E-Fuels), ist klar, dass die Hersteller anderswo produzieren (werden/ müssen).
Die aktuellen Meldungen zum Arbeitsplatz-Abbau bei Herstellern und Zuliefern bestätigen das.
Interessante Meldungen aus der HLK-Branche nicht verpassen - abonnieren Sie unseren kostenlosen, wöchentlichen HLK-Newsletter!
Hier geht’s zur Anmeldung!
